
Simulation und Test 2018
25.09.2018 – 26.09.2018 – Hanau, Deutschland
Kooperationspartner
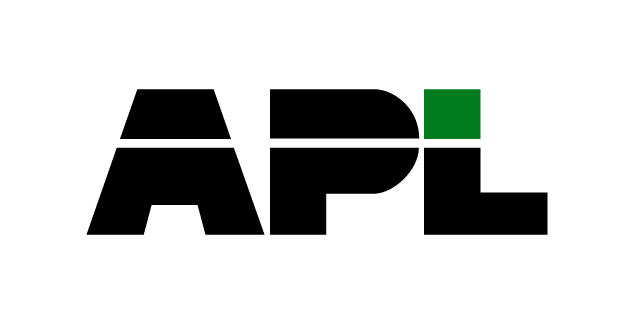


Alexander Kraus / ATZlive

Lange Zeit haben Simulation und Experiment in der Entwicklung von Antriebsträngen konkurriert. Die hohen Anforderungen des RDE-Verfahrens könnten das ändern.
"Vor kurzem hätten wir gesagt, beim Hybrid reden wir über den Antrieb der Zukunft. Tatsächlich ist er mittlerweile ein Antrieb der Gegenwart." Mit diesen Worten beschrieb Dr. Gotthard Rainer von AVL List auf der 18. MTZ-Fachtagung VPC — Simulation und Test die Auswirkungen der zunehmend restriktiven Abgasgesetzgebung auf die Antriebsstrangentwicklung. Der elektrifizierte Antriebsstrang ist Rainer zufolge einer der Schlüssel, um den Vorgaben zu den Emissionen im realen Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, kurz RDE) gerecht zu werden. Der zweite Schlüssel ist der verstärkte Einsatz von Simulationswerkzeugen in der Entwicklung. Darin waren sich die Teilnehmer auf der aktuell stattfindenden Fachtagung in Hanau einig.
Ab September 2017 dürfen Motoren im realen Fahrbetrieb die Emissionsgrenzwerte nur noch um das maximal 2,1-fache überschreiten. Das stellt die Entwickler vor eine Mammutaufgabe: Konnten bisher nach Maßgaben des NEFZ bereits in der Motorentwicklung die gleichen Rollenprüfstände nach den gleichen Verfahren wie bei der Zertifizierung eingesetzt werden, steht mit der Bewertung nach RDE die unwägbare Typenprüfung im Realfahrbetrieb bevor. Plötzlich spielen Fahrverhalten unterschiedlicher Fahrer eine Rolle, unvorhersehbare Verkehrssituationen, wechselndes Klima, Höhenprofile. Dazu kommt: Gleiche Strecken können bei zwei aufeinander folgenden Fahrten völlig unterschiedliche Emissionen hervorrufen. Zudem wird auch der Antriebsstrang immer komplexer: Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor werden künftig genauso unterwegs sein wie Hybridantriebe in unterschiedlichen Topologien und mit verschiedenen Getriebekonzepten. Wie ist dieses Maß an Komplexität für die Entwickler noch handhabbar?
Ganz sicher nicht mit den bisherigen Entwicklungsansätzen, ist sich Professor Dr. Jens Hadler von der APL Group sicher. "Um alle nun anstehenden Typenprüfungen nach dem bisher üblichen Verfahren zu prüfen, bräuchten wir eine um den Faktor 100 größere Anzahl an Rollenprüfständen", sagte Hadler in seinem Keynote-Vortrag zur Veranstaltung. Martin Elbs von IPG ergänzte: "Die Vielzahl der Antriebsmöglichkeiten für Hybridsysteme, verbunden mit der Vielzahl der Steuerungsmöglichkeiten, kann nur über Simulation beherrscht werden."
In seinem Vortrag erklärte Elbs auch, wie die Entwicklung künftiger Antriebsstränge mit einem Hardware-in-the-Loop-Ansatz gelingen kann. Kurz gesagt, der Verbrennungsmotor kommt auf den Prüfstand — alles Weitere wird simuliert: von variablen Straßenbedingungen bis hin zu unterschiedlichen Fahrerprofilen. So soll das Optimum von bestmöglicher Fahrleistung bei gleichzeitig geringen Emissionen gefunden werden. Zusätzlich sollen auch hybride Antriebskonfigurationen — virtuell — zuschaltbar sein. Durch die virtuelle Hinzunahme von Elektromotoren könnten mit vergleichsweise geringem Aufwand eine Vielzahl von Hybridvarianten untersucht werden — noch bevor überhaupt ein Prototyp gebaut würde.
An einem ähnlichen XiL-System arbeitet auch Deborah Schmidt von der TU Darmstadt. In ihrem Vortrag stellte sie fest, dass "die RDE-Anforderungen antriebstrangspezifisch sind, und somit auch individuelle, antriebstrangspezifische Streckenprofile" als Testszenarien definiert werden müssen. Eine Methode zur Identifizierung genau solcher individueller Streckenprofile entwickelt sie in ihrer Arbeit.
Noch bis zum heutigen Mittwoch, 28. September, diskutieren über hundert Teilnehmer aus Industrie und Forschung auf der 18. MTZ-Fachtagung VPC — Simulation und Test in Hanau über die virtuelle und versuchstechnische Entwicklung von Antriebssträngen. Themen sind neben den Auswirkungen der RDE und hybriden Antriebskonzepten auch Kraftstoffmodellierung, NVH und die Modellierung von Verbrennungsmotoren.